Hinterm Pflug zur Kriegszeit
Erlebnisse eines Stadtkindes im [Ersten] Weltkriege
Von E. P. [Else Pfefferkorn]
Herausgegeben vom Vaterländischen Frauenverein Trier Stadt und Land, 1916
(Der Reinertrag fließt der Nationalspende für Hinterbliebene zu E. P.)
Die Schattenbilder wurden von der Verfasserin geschnitten
Zum Geleit
Der König rief und alle, alle kamen.
Voll heiliger Begeist’rung ging’s zur Schlacht,
und als wir von den Kriegern Abschied nahmen,
da haben viele wohl wie ich gedacht:
O Glück, hinauszuzieh’n in ihren Reih’n,
ein Schwert zu haben und ein Mann zu sein!
Doch sollen die – der Dichter spricht’s – nicht klagen,
für die der Herr die Schwerter nicht gestählt,
und dürfen wir auch nicht die Waffen tragen,
so hat’s an Pflichten nie für uns gefehlt.
Der deutsche Mann muss sich der Fahne weih’n,
da springt die Frau an seine Stelle ein.
Nun ist aus tausend Wunden Blut geflossen,
die Treue oft besiegelt mit dem Tod!
Manch leuchtend Auge hat sich schon geschlossen;
da geht an uns der Helden letzt’ Gebot:
„Nehmt euch der Witwen, unserer Waisen an,
lohnt ihnen das, was wir für euch getan!“
Drum hört, ihr lieben Leute, meine Bitte.
Bescheiden ist mein Büchlein nur und schlicht,
und kunstlos sind die kleinen Schattenschnitte –
nehmt’s freundlich auf und kritisieret nicht,
und gebet willig eure kleine Gab’
dem guten Zwecke, dem ich’s gewidmet hab’!

Die Glut des Sommernachmittags lag auf der staubigen Landstraße, als ich mit einer Freundin am 8. August 1914 in ein benachbartes Dorf wanderte [Euren bei Trier]. Wir hatten uns entschlossen, bei der Einbringung der Ernte zu helfen. Dazu war ja verschiedentlich in den Zeitungen aufgefordert worden, und die Zahl der jungen Mädchen, die sich dem Roten Kreuz zur Verfügung stellten, war in unserer Stadt so groß, dass dort kaum noch jemand ankommen konnte. Nun wollten wir uns dem Dorfgeistlichen vorstellen und ihn bitten, dass er uns zur Ausführung unseres Plans behilflich sein möchte, denn wir wären in dem Ort ganz unbekannt.
Wir fanden den freundlichen, alten Herrn in seinem Garten bei der Pflaumenernte. Erst war er sehr erstaunt. Schulbuben seien wohl schon da als Erntehelfer; aber dass nun auch zwei junge Damen kommen wollten wäre doch sehr merkwürdig. Nachdem wir ihm aber versicherten, wir hätten es uns ganz ernstlich vorgenommen, versprach er gern, etwas Passendes für uns zu suchen. Als Bedingung hatten wir gestellt, es solle eine Bauernfamilie sein, die einen Angehörigen im Felde hätte und nicht in der Lage sei, bezahlte Tagelöhner zu halten. Zum Abschied schenkte uns der Herr Pastor eine große Tüte Pflaumen, für den guten Vorsatz, wie er lächelnd hinzufügte.
Und wirklich, als wir am nächsten Tage wieder zu ihm kamen, wusste er eine Stelle für uns. Im letzten Hause eines engen Gässchens wohnte eine junge Frau, die sich allein mit ihren kleinen Kindern recht plagen musste, während der Mann als Landwehr im Felde stand. Frau Dietrich begrüßte uns freundlich, wenn auch sehr verlegen. Der Herr Pfarrer habe ihr schon von uns erzählt; „aber“, meinte sie mit einem Blick auf unsere hellen Sommerblusen, „ihr seid doch viel zu vornehm fürs Bauerngeschäft.“ Wir beruhigten sie darüber und nachdem wir beide eine große Ärmelschürze angezogen hatten, schien sie mehr Vertrauen zu uns zu haben.
Trotzdem „graulte“ es sie doch, uns zu einer Arbeit anzustellen, und während sie uns in das Bohnenfeld vorm Haus schickte, Brennnesseln auszurupfen, beteuerte sie uns immer wieder: „Ihr müsst aber nicht, nur wenn es Euch Freude macht, ich kann das ja nicht von Euch verlangen.“ Nach etwa zwei Stunden wurden wir zum Kaffee gerufen. Danach fuhren wir ins Kornfeld mit Noabisch (Nachbars) Franz, denn einen „Mannskerl“ müssten wir doch dabei haben, sagte die Frau.
Die Fahrt auf dem Leiterwagen mit den Kühen machte uns zwei Neulingen großen Spaß. Auf der Landstraße unter den Bäumen war es auch noch verhältnismäßig kühl. Aber nachher im Kornfeld – nein, welche Hitze! Ich hörte einmal jemanden von „brüllender“ Hitze sprechen; daran musste ich unwillkürlich denken, als die sengenden Sonnenstrahlen so unbarmherzig auf die öden Stoppeln hernieder brannten. Aber endlich war der große Wagen geladen, und wir konnten den Heimweg glücklich antreten, ohne einen Hitzschlag verzeichnen zu müssen.
Wenn aber die Leute meinten, die entsetzliche Hitze hätte uns gleich am ersten Tage von unserer sonderbaren Liebhaberei geheilt, (denn dafür hielten es die meisten zuerst), so belehrten wir sie doch eines Besseren und zeigten, dass die Nachbarn mit Unrecht prophezeiten: „Kathrin, deine Fräuleins kommen nicht wieder, dessen kannst du sicher sein.“ Meine Freundin kam nach einigen Tagen dann doch in einem Lazarett als Helferin an. Da wir glaubten, dass bei Frau Dietrich auch eine einzige Hilfskraft ausreichte, blieb ich allein da.

Zunächst musste das Getreide vollends hereingebracht werden. Mähen hatte es der Mann noch können vor seiner Abreise, aber teilweise waren die Garben noch zu binden und aufzukasten. Ich ging meist mit der Mimi (von Muhme) Rieke und Mimi Jane ins Feld. Die beiden alten Weiblein wohnten nur einige Häuser entfernt und halfen zuweilen aus. Ich befreundete mich recht mit den Zweien, und sie erzählten mir allerhand Stückchen.
So hatte die Mimi Jane schon recht schlechte Erfahrungen mit „Erntehelfern“ gemacht. Einmal kamen zwei Jungen aus der Stadt; sie seien vom Herrn Pastor geschickt, um ihr zu helfen. Die Mimi Jane konnte sich zwar nicht erinnern, den Herrn Pastor um Zusendung von Hilfskräften gebeten zu haben, immerhin, man kann doch nicht zwei Jungen ohne weiteres fortjagen, die einem der Herr Pfarrer schickt. Und die beiden schienen sehr willig und eifrig zu sein, sie wären zu jedweder Arbeit bereit. So, dann sollten sie mal Unkraut ausjäten. Aber als die Alte die Arbeit besah, hatten die Buben nur oben die Köpfe fein säuberlich abgepflückt, das andere hatten sie stehen lassen.
Na, dann sollten sie ihr lieber helfen, Kartoffeln auszumachen. Aber dabei wäre sie schlecht gefahren; kaum eine Kartoffel war heil geblieben, die meisten just mitten durchgehackt. Vielleicht konnten sie ein wenig Holz hauen. Doch die Mimi Jane kam gerade noch zu rechter Zeit, um zu verhindern, dass die Bengel einander die Beine abschlugen mit dem Beil. Eine Viertelstunde später konnte sie ihnen noch glücklich die Sicheln entreißen, die sie sich gegenseitig drohend um die Köpfe schwangen. Sie war daher nicht eigentlich ärgerlich, als die Jungen fanden, sie müssten nach so angestrengter Arbeit auch einmal ruhen. Doch als sich die Alte nach den beiden umschaute, konnte sie noch gerade den Schluss eines interessanten Hindernisrennens mit ansehen, das die Taugenichtse mit ihren armen Geißen veranstaltet hatten. Als sie gar kein Sportverständnis zeigte, sondern im Gegenteil eine Wiederholung des Rennens bestimmt untersagte, verlangten die Reiter entschieden Ersatz dadurch, dass sie sich auf den Obstbäumen „dickesatt“ futtern dürften.
Nachdem sie dieses ausgiebig besorgt hatten, meinten sie, es sei jetzt Zeit für den Heimweg. Schon wollte die Mini Jane erleichtert aufatmen. Doch das wäre übereilt gewesen. So ohne allen Lohn wollten die Jungen doch nicht gehen; das könnte kein ehrlicher Mensch von ihnen verlangen. Es wäre nicht mehr als recht und billig, dass jeder einen Sack Kartoffeln, wenn auch nicht ganz umsonst, so doch zu bedeutend herabgesetztem Preise bekäme. Um die Plagegeister loszuwerden, gab die Bedrängte nach, ja, sie lieh ihnen sogar ihr Handwägelchen zum Heimfahren. Am nächsten Tage würde sie es wiederhaben, dazu das Geld.
Nach acht Tagen brachte einer das zerbrochene Wägelchen und das Geld, der andere hat seinen Betrag heute noch zu bringen. Der Herr Pastor ahnte nichts von der Geschichte.

Den letzten Hafer fuhr ich allein mit Noabisch Franz ein. Auf dem Hinweg leitete ich das Gespann, und er saß auf. Zur Rückfahrt war ich auf den geladenen Wagen geklettert und hatte es mir im Haferstroh bequem gemacht. Es war wirklich ein schönes Fahren auf dem leicht schwankenden Wagen, an den letzten goldenen Ährenfeldern vorbei; Lerchen stiegen jubilierend zum tiefblauen Himmel auf. Bei der Dreschmaschine angekommen, half mein Begleiter mir sehr höflich von meinem Hochsitz.
Zum Danke dafür, dass ich ihm während der Fahrt Eierpflaumen und Mirabellen, die ich aus unserm Garten mitgebracht hatte, zuwarf, wies er mir einen Posten oben auf der Dreschmaschine an. Ich muss, scheint es, sehr verlangend hinaufgeschaut haben; denn als die Reihe des Dreschens an uns war, winkte er mir strahlend zu: „Kommt, klettert mal da herauf!“ Gönnerhaft fügte er hinzu: „Ihr wärt doch sonst Euer Lebtag nicht rauf gekommen, aber ich erlaube es Euch.“ Es war ein recht staubiges Vergnügen; der Kopf brummte mir von dem Lärm und Gerüttel der Maschine und der Rücken tat mir weh von dem vielen Bücken; aber ein Vergnügen war es doch, das ich dem braven Jungen verdankte.
An Noabisch Franz hatte ich überhaupt einen guten Freund. Wenn er Zeit hatte, begleitete er mich zuerst immer auf meinen Fahrten, bis ich selbständig mit dem Fuhrwerk umgehen konnte. Anfangs kostete es mich wohl etwas Überwindung, mein Gespann mit lautem „Hot“ und „Ha“ anzutreiben. Aber ich vergaß bald die Schüchternheit, da ich sah, dass mich niemand auslachte.
Fremde Leute, die mir begegneten, hielten mich für ein Bauernmädchen; ich trug auch Nagelschuhe und geblümte Kopftücher. Die einheimischen Bauern waren alle sehr freundlich zu mir. Mehr als einmal sagten sie mir: „Ihr glaubt nicht, wie es dem einfachen, armen Landmann wohl tut, wenn er sieht, dass die feinen Herrschaften nicht zu stolz sind, seine grobe Arbeit zu tun.“ Ja, sie behaupteten später sogar, dass manche Dorfmädchen erst jetzt sich an Arbeiten gäben, an denen sie früher ihre zarten Hände nicht verderben wollten, nachdem sie gesehen hätten, dass das Fräulein aus der Stadt sich nicht davor scheute.
Bald hatten sich die Leute so sehr an mich gewöhnt, dass sie mich als „unsereins“ betrachtete. Wenn jemand ein Stück Wegs neben mir zu gehen hatte, so fragte er wohl, wie weit „wir“ mit „unserer“ Arbeit wären oder ob „unsere Kartoffeln“ schön seien. Wenn ein Wagen im Schlamm stecken blieb, was recht häufig vorkam, ließen sie mich in die Speichen greifen. Und ich half ihnen gern, den Wagen aus dem Sumpf zu drücken. Die Leute halfen mir dafür bei anderer Gelegenheit auch wieder.
Einmal hatte ich einer Frau in meiner Gutmütigkeit ihren Karren gezogen. Als ein Militärtransportzug ankam, rief sie: „So, nun springt aber, ich will den Zug sehen!“ Gehorsam setzte ich mich mit dem schweren Karren in Trab. An der Straßenecke gab sie mir auch noch ihren großen Tragekorb und ließ mich stehen, während sie selbst, also erleichtert, der Bahn zulief, ihre Neugierde zu befriedigen.
Ein andermal beglückte ich ein Bäuerlein dadurch, dass ich ihm seine zwei verlorene Schafe zuführte. Ich ging gerade die Landstraße entlang, als mir zwei Hämmel entgegen trabten. Da ich wusste, dass niemand in der Nähe Schafe hatte, hielt ich die Tiere fest, was aber nicht so einfach war, da sie sich heftig bäumten und sträubten. Ein Strick, den ich zufällig bei mir hatte, wurde sofort zerrissen. Zum Glück kamen ein paar Buben, die die Ausreißer wieder einfingen. Nun krallte ich mich krampfhaft in die dicke Wolle, und die Schar der Gassenjungen, mit Stecken bewaffnet, umgab mich und meine beiden Opfer, um einen Fluchtversuch der letzteren sogleich zu vereiteln. Trotz vereinter Anstrengungen kamen wir nur sehr langsam von Fleck, und ich beschloss daher, die Hämmel sobald als möglich einem Wagen mitzugeben.
Und wirklich dauerte es nicht lange, bis ein Bauerngefährt angerollt kam. Der seltsamen Gruppe ansichtig, hielt der Mann sofort seinen Schimmel an und stellte freudig fest, dass er nun die „Seinen“ wiederhabe. Während sich der kleinere geduldig auf den Wagen laden ließ, befreite sich der stärkere abermals und wurde fast überfahren von zwei Autos. Das eine wich ihm noch rechtzeitig aus, das andere hielt im letzten Augenblick an. Als man endlich des Flüchtlings habhaft wurde, musste er dafür zur Strafe, mit einem mächtigen Strick an den Wagen gebunden, hinterherlaufen.

Ja, ja, mit eigensinnigen Tieren hat man manchmal seine liebe Not! So machte mir die „Braune“ einmal dadurch Verdruss, dass sie sich standhaft weigerte, durch eine etwa 30 Meter lange Überschwemmung, die den Weg verstellte, zu gehen und mit beharrlicher Bosheit entweder dem Kleeacker zur Linken oder dem Rübenfeld zur Rechten zustrebte. Es war mir zuletzt nichts anderes übrig geblieben, als meinen trockenen Wagen zu verlassen, die Kuh energisch am Horn zu ergreifen, um abwechselnd drohend und bittend mit ihr durchs Wasser zu gehen. Patschnass und bis an die Schulter bespritzt von dem Stampfen der Braunen, entstieg ich auf der andern Seite der Flut.
Ich wäre wahrscheinlich noch ärgerlicher über das Tier gewesen, wenn es mich nicht am Vorabend – bildlich gesprochen – „aus der Patsche“ gezogen hätte, so wie es mich an jenem Tage – wörtlich genommen – hineinzog. Und das kam so: Es war ein fürchterlicher Sturm- und Regentag. Ich hatte mich, von Hause kommend, gut wetterfest ausgerüstet. Den Lodenmantel bis unters Kinn zugeknöpft, den Südwester tief ins Gesicht gezogen, die Hände in die Taschen vergraben, stiefelte ich suchend durch die nassen Felder, ob etwa Frau Dietrich in der Gegend sei, um den „Marktkram“ zu holen. Plötzlich stand nicht Frau Dietrich vor mir, sondern ein Soldat mit aufgepflanztem Bajonett, der mir „Halt“ entgegen brüllte. Natürlich war ich aufs höchste erstaunt, als der „grimmige Krieger“ wie aus heiterem Himmel (allerdings in diesem Falle allerdings aus den Regenwolken) kam; aber da ich ein durchaus reines Gewissen hatte, ließ ich mich nicht aus der Ruhe bringen, auch nicht, als er mir verkündete: „Ich muss Sie verhaften, kommen Sie mit auf die Wache!“
Hier begann nun der Unteroffizier ein langes Verhör. Was ich bei diesem Unwetter in den Feldern zu suchen hätte, fragte er. Ich erklärte ihm den ganzen Sachverhalt, aber kopfschüttelnd meinte er immer wieder: „Sehr merkwürdig! In der Tat sehr merkwürdig!“ Doch endlich entließ er mich mit einem gutmütigen: „Na, für dieses Mal will ich Ihnen Glauben schenken; aber von weitem konnte man Sie wirklich für einen Engländer halten.“ Ich versprach ihm, bald einen ordentlichen Ausweis zu bringen.
Als ich dann eine Stunde später mit dem Kuhwagen an dem Wachtposten vorbeifuhr und, auf die Braune zeigend, fragte: „Sind Sie nun mit diesem Ausweis zufrieden?“, da versicherte er mir lachend: „Allerdings, mit so einem dicken Passierschein hätte ich Sie niemals angehalten.“ Das war das einzige Mal, dass mir die Soldaten „kriegerisch“ entgegentraten. Sonst habe ich sie immer als sehr friedliebende Naturen gefunden, besonders jungen Mädchen gegenüber, an die sie sich gern „heranmachten“. Da sie mich für ein Bauernmädchen hielten, versuchten sie es auch bei mir. Ich muss ihnen aber zur Ehre nachsagen, keiner ist jemals keck gegen mich gewesen.
Als zum Abmarsch geblasen wurde, stand ich gerade vor der Türe. Auf einmal drückte mir einer der ausziehenden Krieger ein Päckchen in die Hand mit den Worten: „Da, junge Frau, lasst ihn Euch gut schmecken, mir stinkt er zuviel im Tornister!“ Es war ein schöner Limburger Käse.

5. In Vertretung der Hausfrau
Zweimal wöchentlich fuhr Frau Dietrich in die Stadt zum Markt. Da gab es immer viel zu tun. Oft hatten wir sechs bis sieben Waschkörbe allein voll Bohnen zu pflücken, ohne die Gelbrüben, die Roterüben, Petersilie und dergleichen. Das Gemüse musste zudem noch geputzt und gewaschen werden. Die Marktvorbereitungen nahmen gewöhnlich fast den ganzen Tag in Anspruch, und kein Wetter durfte uns davon abhalten.
Wir waren oft bis auf die Haut durchnässt, bis wir glücklich alle Bohnen gepflückt hatten, und später im November erstarrten wir fast vor Kälte, als wir den Kohl holten. Aber wenn abends die stattliche Reihe der Körbe fix und fertig dastand, lachte einen das Gemüse nur so an. Und wie mannigfaltig war es doch eigentlich in Form und Farbe! Grün und rot und bläulich und gelb und weiß guckte es da aus den „Mandeln“.
Noabisch Franz begleitete Frau Dietrich meist zum Markt und brachte dann die Kuh mit dem leeren Wagen zurück. Ich ging an den Markttagen morgens nicht ins Feld, sondern vertrat die Hausfrau in ihrer Abwesenheit. Es war auch im Hause Beschäftigung genug. Bis das Geschirr gespült war, Stube und Treppe geputzt und die Kinder noch vollends zu Recht gemacht waren, konnte man bald ans Kochen denken. Wenn die Töpfe auf dem Herd standen, reinigte ich gewöhnlich den Stall. Ich konnte ja nicht ins Feld gehen, und dann ließ sich der enge Stall auch besser säubern, wenn nicht alle Tiere darin waren.
Wenn die Kuh vom Markt zurückgekommen war, fing ich mit dem Füttern an. Während das Heu verzehrt wurde, bereitete ich den Trank. Drei Körbe voll Runkelrüben aus dem Keller wurden durch die Hackmaschine gedreht, dazu ein halber Eimer kleine Kartoffeln, drei Maß Kleie und Abfall von grünem Gemüse. Das wurde in einer großen Bütte durcheinander gemengt und mit drei Eimern Wasser aufgefüllt. Ich weiß das Rezept noch auswendig. Als der Krieg länger dauerte, mussten wir die Kleie aus dem Speisezettel streichen. Außer den zwei schon erwähnten Kühen stand noch ein Rind im Stall. Dadurch, dass ich sie fütterte, gewöhnten sich die Tiere schnell an mich.
Mit welcher Gier fielen sie stets über den gefüllten Trinkeimer her! Das Heu rissen sie mir von der Gabel, ehe ich es aufstecken konnte. Das Rind, das mich mit lautem Freudengebrüll begrüßte, führte in seiner Wonne ordentliche Tänze auf, und es kam ihm dabei gar nicht darauf an, wenn es mich einmal trat oder mit seinem Schwanz ins Gesicht schlug. Ich nahm ihm auch nichts übel.
Wenn das Vieh besorgt war, hieß es wieder ans Essen denken, dass nichts anbrannte. Die Kinder wären zwar keine allzu scharfen Kritiker gewesen; denn was “die Freilein“ kochte, war gut, musste ja in ihren Augen gut sein. Frau Dietrich selber hätte auch nie etwas über das Essen gesagt, dazu war sie viel zu gut erzogen.
Beyers Klärchen von nebenan kam einmal herüber und hob, so ganz nebenbei, den Topfdeckel auf, und die Mimi Rieke bat um eine Kostprobe. Noabisch Franz, der sonst immer zu Mittag nach Hause ging, wollte sich auch nicht „die Ehre entgehen lassen“, mit zu essen, wenn die Fräulein gekocht hatte.

Bei schönem Wetter war die Zeit des zweiten Grasschnittes gekommen, und meine Freude war groß, als es hieß: Morgen gehen wir auf den Berg ins Grummet. Die Mimi Jane, die Mimi Rieke und ich bewaffneten uns also mit Holzrechen und Heugabeln und machten uns auf den Weg. In der Hotte [Rückentragekorb] nahmen wir Brot, Wurst und Viez [Apfelwein)] mit. Die Sonne brannte heiß und wir waren froh, als wir in die kühle Waldschlucht kamen. Nachdem wir etwa eine Stunde lang durch das lauschige Buchengrün bergan gestiegen waren, lichtete sich der Wald und unter einer mächtigen Eiche verzweigte sich der Weg. Hier trennten wir uns von einem alten Weibe, das uns bis dahin begleitet und gruselige Wilderergeschichten erzählt hatte. Wir folgten nun einem schmalen Feldweg und hatten bald unsere Wiese erreicht. Sie lag wunderschön auf freier Höhe.
Und wie herrlich war der weite Blick auf die herbstlich bunten, sonnenüberfluteten Lande mit dem klaren Herbsthimmel darüber! Der blaue Enzian blühte, und aus dem bräunlichen Land der Hecken hervor leuchteten die feurigen Hagebutten. Muntere Schmetterlinge flatterten umher, und die Grillen zirpten; unsere Schürzen und Kopftücher wehten lustig im Winde, während wir das duftige Futter wendeten und auf Haufen setzten.
Gegen Abend setzten wir uns unter den riesigen Birnbaum bei dem uralten, verwitterten Bildstock und verzehrten unser Brot. Es war feierlich still ringsum, nur das Glöcklein irgendeines Dörfchens klang zu uns herauf. Mir ward ganz andächtig zumute, und auch meine beiden Begleiterinnen empfanden den Frieden der Stunde, der so seltsam abstach gegen alle Unruhen des Krieges. Gesprochen haben wir kaum. Wir hatten alle denselben Gedanken: Hier ist gut sein! Doch der ferne, aber deutlich zu vernehmende Schlachtendonner gemahnte uns eindringlich an die furchtbar ernste Wirklichkeit. Ein Zeichen des Krieges war auch der Flieger, der scheinbar so friedlich seine Kreise an dem glühenden Abendhimmel zog.
Über den Heimweg war es völlig Nacht geworden, und das letzte Stück des Weges leuchtete uns der klare Vollmond. Durch die bunten Scheiben der Waldkapelle flimmerte das Licht der Opferkerzen, und im Vorbeigehen hörten wir die Fürbittengebete für unsere Krieger.
Der nächste Tag brachte ebenso günstiges Wetter, und wir hofften, dass wir schon am folgenden Morgen mit dem Einfahren beginnen könnten, denn Sonne und Wind hatten es gut mit uns gemeint. Der Grummet war so locker und würzig geraten, wie man es besser nicht hätte wünschen können. Darum sahen wir mit Besorgnis, wie sich der Himmel mehr und mehr bewölkte, und die Mimi Rieke deutete auch die vielen Kröten, die uns über den Weg krochen, als schlechtes Vorzeichen.
Leider sollte sie damit Recht behalten; denn gerade als wir anspannen wollten zur Bergfahrt, fielen die ersten Tropfen und nach Verlauf von kaum einer Viertelstunde hatte das schrecklichste Unwetter eingesetzt. Es regnete und regnete, drei ganze lange Wochen, und als sich endlich alles Wasser verlaufen hatte, waren nur noch kleine, schwarze Häufchen übel riechenden Futters übrig.
Ich bewunderte Frau Dietrich, wie sie es hinnahm. Ich, das Stadtkind, das es im Grunde eigentlich gar nichts anging, hätte weinen mögen. Ein richtiger Landwirt darf eben nicht gleich nach jeder fehlgeschlagenen Hoffnung den Kopf hängen lasse, das musste ich noch lernen.

Während sich das Laub immer mehr verfärbte, begann auch das Kartoffelkraut schwarz und trocken zu werden, ein Zeichen, dass mit der Ernte begonnen werden müsse, eine neue ungewohnte Arbeit für mich. Anfangs spürte ich das Kreuz recht tüchtig von dem vielen Bücken, aber nach einer Woche war ich’s gewohnt. Für die Kartoffelzeit hatte Frau Dietrich auch einen Tagelöhner, den „langen Kaspar“, angenommen. Die Mimi Rieke und Mimi Jane halfen auch öfter, so ging die Arbeit ganz gut voran.
Um Zeit zu sparen, aßen wir mittags im Felde; es schmeckte immer besonders gut im Freien. Auf den Kartoffelsäcken saßen wir schön um die Schüssel herum, und wenn der Tonkrug mit dem Apfelwein kreiste, fehlten auch die muntern Reden nicht. Wenige Wochen nur lagen dazwischen, seit ich zum letzten Mal in fröhlicher Tafelrunde unterm blauen Himmel saß, und doch: welch himmelweiter Unterschied! Unwillkürlich musste ich daran denken.
Damals war es auf einem Regimentsfeste. Nach einer reizenden Dampferfahrt auf dem lieblichen Fluss saß die vergnügte Gesellschaft in ihren hellen, duftigen Kleidern (die Herren hatten auch ihre Uniform mit einem leichten Sommeranzug vertauscht) an weiß gedeckten Tischen im kühlen Baumesschatten. Bei all dem Plaudern und Scherzen merkte man gar nicht, wie die Zeit verflog und die Sonne hinter den waldigen Bergen sank. Das war vor dem Krieg, - und nun: die sorglosen jungen Offiziere von damals standen in blutiger Schlacht, Mann gegen Mann vor dem Feind. Und wie manchen deckte schon der grüne Rasen, der sich damals noch so herzlich freuen konnte! Und die jungen Mädchen? Wohl die meisten trugen jetzt die schlichte Tracht der Pflegerin, nur ich nicht – ich saß, eine schmutzige Feldarbeiterin, zwischen Tagelöhnern auf einem alten Sack; mein Essen hatte ich mir redlich mit Kartoffelbuddeln verdient. Ja, der Krieg!
Aber der „lange Kaspar“, der neben mir saß, ließ mich nicht viel zu tiefsinnigen Betrachtungen kommen. Ich hörte ihm immer besonders gern zu, wenn er von dem Leben der Holzfäller erzählte. Er war früher stets im Winter mit in den Wald gegangen. Er liebte den Wald auch jetzt noch, wie überhaupt die freie Natur und hätte wahrscheinlich ein Leben, wie es seine Brüder führten, gar nicht ausgehalten, wenn er sie in seinem Herzen vielleicht auch heimlich ein bisschen beneidete.
„Mein einer Bruder ist im Kloster“, erzählte er. „Für den wird gesorgt, der hat sein Leben lang keine Sorgen mehr. Nächste Woche geht er nach Amerika in ein Filialkloster. Da sieht er nun die schöne weite Welt und das große Meer, und wenn er stirbt, hat er sich den Himmel verdient. Mein anderer Bruder meinte auch, er sei am besten in einem Orden aufgehoben und trat ein Jahr danach ebenfalls ein. Aber er konnte sich nicht unter fremdem Willen fügen und konnte ohne Freiheit nicht leben. Der trat bald wieder aus. Aber heiraten tut er nicht, sondern lebt als ein frommer Mann in Straßburg. Dort hat er sich in der Nähe des Münsters ein Zimmer fein eingerichtet und verdient in seiner Schlosserei ein schönes Geld. Er hat viele Heiligenbilder in seiner Stube, viele Vögel und einen Affen und ist, wie gesagt, sehr fromm und gottselig.“
Allmählich wurde ein Feld nach dem andern leer; nun hatte Frau Dietrich die Sorge, wer wohl nachher umpflügen würde. Sie hatte schon bei allen möglichen Leuten angefragt, kein „Mannskerl“ war zu haben. Sie seien froh, wenn sie ihre eigene Arbeit geschafft hätten war immer die Antwort.

8. Der Hausherr im Urlaub
Eines Tages gab es eine große Überraschung. Als ich morgens in das Gässchen einbog, erfuhr ich gleich von Tobler Mimi: „Er ist gekommen!“ und Knandel Gritchen ergänzte: „Heute morgen um 4 Uhr.“ Tante Schlast (Scholastika) rief aus dem Fenster: „Hent Ihr ihn schu gesieh?“ (Habt Ihr ihn schon gesehen?) Und Beyer Öhmchen stellte fest: „En sieht ewer gutt aus!“
Ich wusste natürlich sofort, wer gemeint war und freute mich sehr, nun auch einmal meinen eigentlichen Dienstherrn kennen zu lernen, war ich doch verschiedentlich nach ihm gefragt worden. Wenige Tage zuvor hatte sich ein Mann nach meinem Herrn erkundigt, und als ich zuerst einen Augenblick im Zweifel war, wer mein „Herr“ sei, hatte der Mann ergänzt: „Ei, Euer Herr, wo Ihr in Arbicht seid.“
Franz Dietrich hatte ziemlich lange Urlaub bekommen und hoffte, bis zum Ablauf desselben mit der Winterbestellung der Felder fertig zu werden. So fing er an, während wir noch mitten in der Kartoffelernte waren, die ersten Äcker umzupflügen. Als ich ihm einmal zusah, fragte er mich, ob ich wohl auch Lust dazu hätte. Na und ob! Es war ja schon lange mein Wunsch; aber Frau Dietrich hatte dann allemal gesagt: Das ist kein Weibergeschäft. Freudig ergriff ich den Pflugsterz. Dietrich ging nebenher und sagte mir immer, wie breit ich anhalten müsse. Scherzend meinte er, ich hätte „Genie“ für die Arbeit, und von nun an war ich immer dabei, wenn er ackerte. Ach, wie war ich stolz!
Das letzte Feld, das wir gemeinsam bearbeiteten, lag etwa ¾ Stunden weit vom Dorf entfernt. Da dort ein militärisches Gebäude in der Nähe war, so bedurfte es in der Kriegszeit eines besonderen Ausweisscheines, um in die dortige Feldergegend zu kommen. Auch ich bekam vom Ortsvorsteher eine Bescheinigung ausgestellt, mit einem gewichtigen Amtsstempel darunter. Während der langen Fahrt hatte Dietrich Zeit, mich über allerhand Wissenswertes in der Landwirtschaft zu belehren.
Endlich waren wir am Ziel. Der Regen, der schon unentwegt begonnen hatte, war stärker und stärker geworden. Nun setzte auch ein ziemlich heftiger Sturm ein. Der Boden war bald gänzlich aufgeweicht, man sank bei jedem Schritt fast bis an die Knöchel ein. Aber es half nichts, den weiten Weg wollten wir nicht umsonst gemacht haben.
Hei, das war nun eine Lust! Der Regen klatschte mir ins Gesicht, der Sturm zerzauste mein Haar, und bald triefte ich nur so, während ich mit den lehmschweren Stiefeln durch die Furche stapfte. Ich fühlte mich im Augenblick nicht schlechter als ein Bauer, und wie freute mich Dietrichs Lob, als er sagte: „Es ist wahrhaftig ein Jammer um Euch, das Ihr nur als Mädchen in der Stadt geboren seid. Ihr hättet müssen als Bauernbursch auf die Welt kommen, da wäre noch was Tüchtiges aus Euch geworden!“

Endlich waren die letzten Kartoffelsäcke aufgeladen und das leere Feld harrte der Wintersaat, die Dietrich noch glücklich am letzten Tage seines Urlaubes erledigen konnte. Ich war inzwischen in der Kunst des Pflügens soweit fortgeschritten, dass ich diejenigen Äcker, die nicht eingesät, sondern bloß umgebrochen zu werden brauchten, selbständig fertig bestellen konnte. Dabei half uns der Vetter Hias; denn wenn ich auch die Fuhre auf das Feld bringen konnte, so war doch noch niemand da, der den Dünger aus der Kaserne holte.
Vetter Hias war weder groß noch kräftig, aber fleißig und gefällig. Was mir indessen besonders gut an ihm gefiel, war seine Art und Weise, mit Tieren umzugehen. Wenn die Kühe so schwer zu ziehen hatten, ließ er sie stets von Zeit zu Zeit ausruhen. Dann streichelte er sie freundlich und nahm ihnen die Joche ab, damit sie, für einige Augenblicke vom Druck befreit, ihre Stirnen kühlen könnten. Zu Nero, dem Hund, war er ebenso nett. Als die Bulldogge sich einmal vor ihn hinsetzte und verlangend nach dem Brot schaute, das der Junge zum Kaffee aß, sagte er: „Nero, du bist zu hässlich, nein, wirklich, du bist zu hässlich. Was hast du überhaupt für ein plumpes Gesicht und für vorstehende Zähne! Geh fort, du guckst mich so gierig an mit deinen großen Glotzaugen.“ Aber gleich darauf reute es ihn und er rief den Hund zu sich: „Eigentlich kannst du nichts dazu, dass du so abschreckend bist, der liebe Gott hat dich so gemacht; du hättest dir wohl auch nicht diese Gestalt ausgesucht. Komm, du sollst auch ein Stückchen bekommen, weil du gar so abschreckend bist, du armer Tropf! Seitdem war ich dem Vetter Hias gut.
Das letzte Stück, welches ich umackerte, kannte ich sogleich wieder, war es doch dasselbe Feld, auf dem ich meine landwirtschaftliche Tätigkeit begonnen hatte. Aber hatte ich an jenem Augusttage unter der übergroßen Hitze zu leiden, so war jetzt das Gegenteil der Fall. Ein eisigkalter Wind ließ meine Hände bald am Pflug erstarren. Von Zeit zu Zeit setzte ein Schneetreiben mit Regen vermischt ein. Und das Vieh zog so langsam, ach, so langsam. Ich hätte verzweifeln mögen.
Es fuhr sich allerdings auch schlecht, das gebe ich zu. Sowie das Korn eingebracht war, hätte das Stoppelfeld gestürzt werden müssen; aber damals konnte ich eben noch nicht pflügen. So war das Land so lange liegen geblieben und ganz von Unkraut und wildem Klee durchwuchert. Da die Tiere trotz ständiger Aufmunterung nur noch Schrittchen für Schrittchen zogen, so verlor die Pflugschar sehr an Gewalt, sie wendete die Erde nicht mehr, sondern hob sie nur noch heraus. Wo das der Fall war, musste ich allemal halten und die Scholle mit den Händen richtig legen; es war kein Fortkommen.
Ich hatte die Länge des Tages überschätzt und die Länge des Ackers unterschätzt. Als ich die letzte Furche abfuhr, war es bereist so dunkel, dass ich nur noch wenige Meter vor mir sehen konnte. Da ich keine Wagenlaterne mit hatte, so musste ich die breite Landstraße meiden und den Feldweg einschlagen, der zu beiden Seiten mit verkrüppelten Weidensträuchern bestanden war und zwischen Sümpfen und Tümpeln hindurch führte. Glücklich gelangte ich auch mit meinem Fuhrwerke ans Ziel, nachdem wir mehrmals beinahe stecken geblieben waren.
Unterwegs hatte ein gräuliches Unwetter eingesetzt, dabei ein Sturm, dass die Decken, die ich den Kühen aufgelegt hatte, andauernd fort geblasen wurden und ich das Nachlaufen hatte. Da ich die Nutzlosigkeit meiner Bemühungen einsah, zog ich vor, mich selber in die Decken zu hüllen. Als mir ein Windstoß den Hut weggetrieben hatte und ich ihn patschnass aus einer Pfütze ziehen musste, zog ich die eine Decke über den Kopf und kutschierte nun vollständig als Mumie durch die Landschaft.
Als Kind hätte es mir sicherlich den größten Spaß gemacht. Die nächtliche Fahrt auf einem Rinderwagen durch eine verwilderte Sumpfgegend, das wären doch Anregungen zu den herrlichsten Abenteuerphantasien gewesen. Es fehlten nur noch Indianer oder Raubtiere, die plötzlich aus dem Dickicht hervorbrechen und das einsame Gefährt überfallen. Der Landwirt ist prosaischer veranlagt. Er freut sich, dass er die Arbeit geschafft hat, ehe es ihm die Dunkelheit verwehrt; er sorgt sich, dass sein Vieh der Unbill des Wetters ausgesetzt ist und treibt die Tiere zur Eile an. Auch ich empfand nun als Landwirt.
Die Runkelrübenernte war inzwischen auch beendet; aber Arbeit war noch genug da, bis der letzte Kohl und was sonst an Gemüse noch auf den Feldern stand, hereingeholt war. Als ich im August als „Erntehelferin“ gekommen war, hatte ich gedacht: hier wirst du wohl drei bis vier Wochen Beschäftigung finden. Aber ein Tag hatte sich an den anderen gereiht: aus Wochen waren Monate geworden und schließlich war es zwei Tage vor Weihnachten, als ich mich zum letzten Male abends auf den Heimweg machte, von Frau Dietrich unter den herzlichsten Dankesworten bis vor das Dorf begleitet.

Gern hatte ich Frau Dietrich beim Abschied versprochen, im Frühling wiederzukommen, wenn dann noch Krieg sei. Denn auch ganz abgesehen von dem frohen Bewusstsein, mich hier tatsächlich nützlich machen zu können, freute ich mich darauf, einmal die Naturvorgänge eines ganzen Jahres und ihre Beziehung zur Landwirtschaft zu beobachten. Bis jetzt hatte ich nur immer die Ernte erlebt, noch nie das Entstehen und die Entwicklung.
Verschiedentlich war ich im Winter hinausgegangen, um nach dem Stand der Saaten zu schauen. Ich ließ mich denn auch nicht lange von dem ersten warmen Sonnenschein nötigen. Als aber gar die Vöglein anhuben mit ihrem lustigen Gezwitscher, war mir bald die ganze Stadt zu eng. Noch blühten und dufteten die Veilchen nicht, aber mit Wonne sog ich den würzigen Erdgeruch ein, der der dampfenden Scholle entströmt.
Ja, jetzt begriff ich, was es für ein Ding ist um die Scholle, die der deutsche Landmann so liebt. Der Boden, den ich bestellte, war ja nicht mein und doch – war er nicht ein Stück meiner geliebten Heimat, unseres deutschen Vaterlandes, das sie uns nicht lassen wollen? Der Bauer, der sonst diesen Pflug führte, trug jetzt die blanken Waffen, um das Reich nach außen hin zu schützen; da mochte das deutsche Mädchen den friedlichen Stahl ergreifen, um den Feind im Innern niederzuzwingen. Dumpf dröhnte in der Ferne der Geschützdonner von der Westfront, knirschend durchschnitt mein Pflug das Land und sein Rauschen klang mir wie liebliche Musik in den Ohren. Zunächst mussten die Haferfelder eingesät werden. Und da die eine Kuh erst kürzlich Mutter eines munteren Kälbchens geworden war, hatten wir uns, um sie zu schonen, einen Gaul geliehen.
Ich war von jeher ein leidenschaftlicher Pferdefreund und auf einem lebhaften, charaktervollen Tier über die Heide und durch den Wald zu sprengen, bedeutet für mich den Inbegriff aller irdischen Wonnen. Wie bescheiden hatte der Krieg mich gemacht! Ganz glücklich war ich, nun einige Tage mit einem Ackergaul Feldarbeit tun zu dürfen; denn Pferd bleibt Pferd, sei es noch so plump und struppig, es steht immer noch einige Grade höher als das Rindvieh. Mindestens zehnmal riefen mir Leute nach: „Ihr seid aber tüchtig, dass Ihr es schon bis zum Pferd gebracht habt!“ und ich ließ dann meinen wackeren „Hans“ auch sehr bewundern.
Mein Weg führte über den Exerzierplatz und hier stellte sich mir das erste Hindernis entgegen in Gestalt eines Wachtpostens. Doch ich sagte ihm, er solle mich nur durchlassen, damit ich das Feld bestellen könnte, andernfalls wäre er mit schuld daran, wenn der englische Aushungerungsplan gelänge. Diese Verantwortung wolle er nicht übernehmen, meinte er lachend: aber dann wandte er ein, ich sei überhaupt kein Bauer, meine Sprache verriete mich, und er könne nicht glauben, dass ich wirklich Feldarbeit täte. Da zeigte ich ihm meine ölgetränkten, schweren Nagelschuhe, in denen ich doch gewiss nicht zum Scherz spazieren ginge. Da brach er in den Ruf aus: „Dunnerknippchen, was Stiebel, wahrhaftig, die überzeugen mich! Sie haben sich also gewissermaßen bei den Bauern für die Kriegsdauer verdingt“, fuhr er fort, „und tun es aus Vaterlandsliebe.“ „Wenn Sie es so nennen wollen – ja“, antwortete ich. Da machte er mir eine militärische Ehrenbezeigung und gab mir den Weg frei.
Es war wirklich gut, dass ich ein gut Teil Tatendrang in mir spürte; denn hier wurde ich auf eine harte Probe gestellt. Das Stück fuhr sich so „untugend“, wie ein alter Bauer sagte, wie nur möglich. Der arme Gaul hatte sehr schwer zu ziehen. Um die Arbeit zu bewältigen, nahm er seine ganze Kraft in einem mächtigen Anlauf zusammen und stürmte vorwärts. Ich musste im Laufschritt hinterdrein springen. Der Pflug stieß hin und her, die verpelzten Schollen flogen in die Furche, so dass ich bald nach links, bald nach rechts Sätze machen musste. Ich dachte: In diesem Tempo wird das Tier gewiss nicht lange rasen. Da blieb es auch schon stehen mit einem Ruck, dass ich fast vornüber flog. Es stand ganz außer Atem und keuchte. Dann nahm es wieder einen heftigen Anlauf und bald nochmals mit einem Stoß anzuhalten. Vergeblich suchte ich das Pferd durch beruhigende Zurufe zu langsamerer Gangart zu veranlassen; es stürmte mit der gleichen Hast weiter. Immer häufiger wurde es müde, so dass es zuletzt alle zehn Schritte stehen blieb und keuchte. Bald war es nass und dampfte; mir war es auch nicht kalt.
Ein paar dienstfreie Soldaten kamen vom Exerzierplatz und sahen zu. Einer meinte etwas großartig: „Na ja, man sieht’s, dass Ihr noch nicht viel gepflügt habt; das Ding ist ja ein Kinderspiel. Allerdings, der Gaul ist zu hastig und geht ungleichmäßig, aber trotzdem…“ Ich schlug ihm vor, die nächste Kehre zu fahren, falls er Zeit habe, während ich Atem holte. „Mit größtem Vergnügen!“ sagte er und ergriff den Pflug.
Hans zog an. „Herjeh, herrjeh, wat en kollerig Perd, langsam, langsam, langsaaam!“ brüllte er, während er rasende Sprünge machte. Da stand der Gaul wieder mit einem Ruck. „Nein, du sollst nicht stehen bleiben, du sollst nur langsam gehen – also weiter!“ Aber mein guter Hans nahm sich alle Zeit zum Verschnaufen. Als er wieder Luft hatte, kam der nächste Anlauf. „Du dummes Tier“, konnte der Soldat noch schreien, da flog ihm ein Erdenkloß an den Fuß, dass er taumelte. Der Pflug entfuhr seinen Händen und Hans, der sofort den verringerten Widerstand spürte, rannte umso rascher weiter. „Na, nu lauf’ doch wenigsten nicht ohne mich fort!“
Die andern Soldaten und ich, die wir dem Schauspiel zusahen, bogen uns vor Lachen, und ich muss gestehen, für den Augenblick war ich vollkommen einverstanden mit dem Sprichwort: Schadenfreude ist die reinste Freude. Hatte doch gerade dieser Mann vorher so schön die Furchen durch sein Fernrohr kritisiert. Nun war er geheilt und gab bescheiden zu: „Damit hätte selbst ein Mannskerl Arbicht.“
Den zweiten Tag kam der „lange Kaspar“ aufs Feld, um den Hafer zu säen. War es am ersten Tag schon schlechtes Wetter, so goss es nun in Strömen. Aber es durfte keine Zeit verloren werden, da half alles nichts. Dem Pferde hatten wir eine Decke aufgelegt; aber Kaspar konnte beim Säen ebenso wenig eine brauchen wie ich beim Pflügen, so troffen wir beide um die Wette. Aber keinem von uns dreien hat der kalte Märzregen geschadet; und was die Hauptsache war: Der Hafer ist gut aufgegangen.
Zu guter Letzt zerbrach ich noch die Egge. Kaspar flickte sie zwar sehr kunstvoll mit einem Strick zusammen und versicherte, so hielte sie noch mindestens vier Wochen; aber schließlich waren wir beide doch recht froh, als wir sie glücklich auf den Wagen geladen hatten. Der Stellmacher, dem ich meine Tat gestand, lachte: „Ja, ja, ein starker Gaul und ein stämmiges Mädchen sind zuviel der Kraft für eine alte Egge und das ist gut: wir Stellmacher wollen auch leben.“

Als der Hafer endlich ausgesät war, begannen wir mit der Bestellung der Runkelrübenfelder. In unserer Gegend bauen die Leute nicht nur Rüben für den eigenen Bedarf an, sondern ziehen auch Pflänzchen für den Versand nach auswärts. Diese werden dann im Mai in Bündeln zu tausend gerupft und gut verpackt in kältere Gegenden geschickt, wo sie gut anwachsen und weiter gedeihen, während Samen dort nur spärlich aufgehen würden. Einige Zeit vor dem Rupfen müssen die Felder gehackt und vom Unkraut befreit werden. Doch stehen die „Samrummeln“ (die zum Versand bestimmten Pflanzen) viel zu dicht, als dass man sie mit der großen Hacke bearbeiten dürfte. Die kann man nur, auf den Knien rutschend, „hickeln“, wie die Leute sagten und zwar mit einer kleinen Handhacke. Überhaupt der Krieg mit dem Unkraut! Hat man das eine Feld sauber, so ist das andere Feld voll, und ist man glücklich mit allen fertig, dann kann man wieder von neuem anfangen.
Gewöhnlich kommen die auswärtigen Händler im Frühjahr und machen ihre Bestellungen auf so und so viel tausend. Sobald das Wetter in ihrer Gegend günstig ist, schicken sie telegraphisch Bescheid. Dann beginnt eine fieberhafte Tätigkeit, von morgens 4 Uhr bis zur einbrechenden Nacht. Häufig trifft sich’s dann noch so, dass die Telegramme verschiedener Händler an demselben Tage einlaufen. Da weiß man gar nicht genug Leute zu bekommen. Alle Nachbarn müssen helfen; dafür hilft man ihnen ein andermal wieder, wenn sie „unter Druck“ sind. So habe ich einmal einen ganzen Tag für Knandels gerupft. Weil ich nicht in aller Frühe den weiten Weg ins Dorf hinaus allein machen sollte, ging unser Hausmädchen mit und half auch bis 12 Uhr. Es war noch dunkel, als wir von Hause fort gingen; freundlich glitzerte der Morgenstern. Die Nachtigallen schlugen im dichten Gebüsch, kein fremder Laut störte ihr Lied. Selbst die Luft schien noch zu schlafen; erst nach einer ganzen Weile strich der Morgenwind säuselnd durch die Bäume. Als wir das Feld erreichten, kamen auch gerade Knandel Öhmchen und seine Tochter ans Stück; wir konnten erst nur ihre Umrisse als schwarze Schattenbilder in der Dämmerung unterscheiden. Sonst war noch kein Mensch in der Flur, aber vom Dorfe her scholl Hahnenschrei.
Bald senkte sich der kühle Tau hernieder und die ersten rötlichen Strahlen, die die aufgehende Sonne ankündigten, glänzten darin wie Rubine. Mehr und mehr erblichen die Sterne, ihr Glanz musste dem sieghaften Tageslicht weichen. Die Nachtigallen waren verstummt, aber jubelnd begrüßten die Lerchen den jungen Tag. Um 5 Uhr erklang die Betglocke. Nun kamen auch die andern Nachbarn zum Helfen. An jenem Tage rupften wir 150.000 Stück, was eine ermüdende Zählerei bedeutete.
Knandel Öhmchen bedankte sich nachher sehr nett bei mir: „Ich möchte Euch meinen besten Dank aussprechen für die gute Hilfe. Ich weiß, dass Ihr nichts annehmt. So verspreche ich Euch, der Frau Dietrich zu helfen, so viel in meinen Kräften steht. Ich denke, das ist in Eurem Sinn.“ Und er hat sein Wort gehalten. Ob er wohl wusste, wie sehr mich dieser Dank erfreute?

Die Runkelrüben waren noch nicht alle gerupft, als wir bereits ins Heu gingen, gewiss zwei bis drei Wochen früher als in den andern Jahren. Infolge der außerordentlichen Trockenheit drängten sich die Arbeiten so zusammen, dass man oft nicht recht wusste, wo zuerst anfangen. Das Bepflanzen der Gemüsefelder war in diesem Jahr auch viel zeitraubender als sonst. Die zarten Pflänzchen wären gewiss in dem harten trockenen Boden verdorrt, wenn wir sie ohne weiteres von dem Beet ins Land versetzt hätten. Vergeblich warteten wir auf den erquickenden Regen. Es blieb uns schließlich nichts anderes übrig, als fünf Fuder Wasser aufs Feld zu fahren und dort mit Kannen auszutragen. An einem Tage habe ich von morgens 4 Uhr bis abends 7 ½ Uhr nichts anderes getan, als Wasser geschleppt, während Frau Dietrich die Kohlpflänzchen setzte. Und das fiel gerade in eine Zeit, wo es auch mit den Kartoffeln, die wir um Ostern gesetzt hatten, so viel Arbeit gab. Die Felder wollten doch geschleift, geeggt, gehackt und gehäufelt sein.
Bei der Heubereitung allerdings bedeutete die Trockenheit eine große Zeitersparnis. Das Heu dörrte sozusagen am Halm. Die Wiesen, die Dietrichs mit Nachbar Beyers zusammen hatten, lagen auf einer Höhe, etwa 10 km vom Dorf entfernt. Ich kann vom ersten Jahre her nur die kleinere Wiese bei dem alten Bildstock, die Dietrichs allein gehörte. Der kürzeste Weg führte durch eine herrliche Waldschlucht. Er war so gefährlich, dass man nicht mit einem geladenen Wagen dort fahren konnte, sondern der Landstraße folgen musste, die in großen Windungen langsam ansteigt.
Zu schnell verging mir die Heuzeit. Die Nachbarsmädchen zwar waren froh, als sie nicht mehr täglich den weiten Weg zu machen hatten; ich konnte das nicht begreifen. Mir war jeder Tag ein Fest; denn was gibt es Schöneres, als vom Morgen bis zum Abend in freier Natur zu sein, wo sie am lieblichsten ist? Wohltuendes Grün, wohin auch das Augen sich wendete und darüber lachte ein blauer Himmel, von keinem Rauch und Qualm aus Fabrikschloten getrübt! Kein ratterndes Auto keuchte vorbei, um, Benzingeruch verbreitend und Staub aufwirbelnd, die reine Bergluft zu verderben. Nur dann und wann rollte ein Bauernwagen vorbei und wir wechselten Grüße mit dem Fuhrmann, der unter dem Plandach behaglich sein Pfeifchen schmauchte. Am Wege blühten die Heckenröschen und wenn wir unter dem Apfelbaum mittags unser Brot verzehrten, sorgten die brummenden Käfer für Tischmusik. Und obendrein das Gefühl zu haben, nicht nur unserm Herrgott den Tag zu stehlen, sondern einen guten Zweck damit zu verbinden: nein, wirklich, das Heumachen war keine schwere Arbeit! Abends kostete es mich immer ordentlich einen Entschluss, den Heimweg anzutreten und heimlich beneidete ich den langen Kaspar, der nicht eher wieder ins Tal hinunter kam, bis er die ganze Wiese abgemäht hatte. Er übernachtete in einer kleinen Steinbruchhütte, um morgens recht zeitig anfangen zu können.
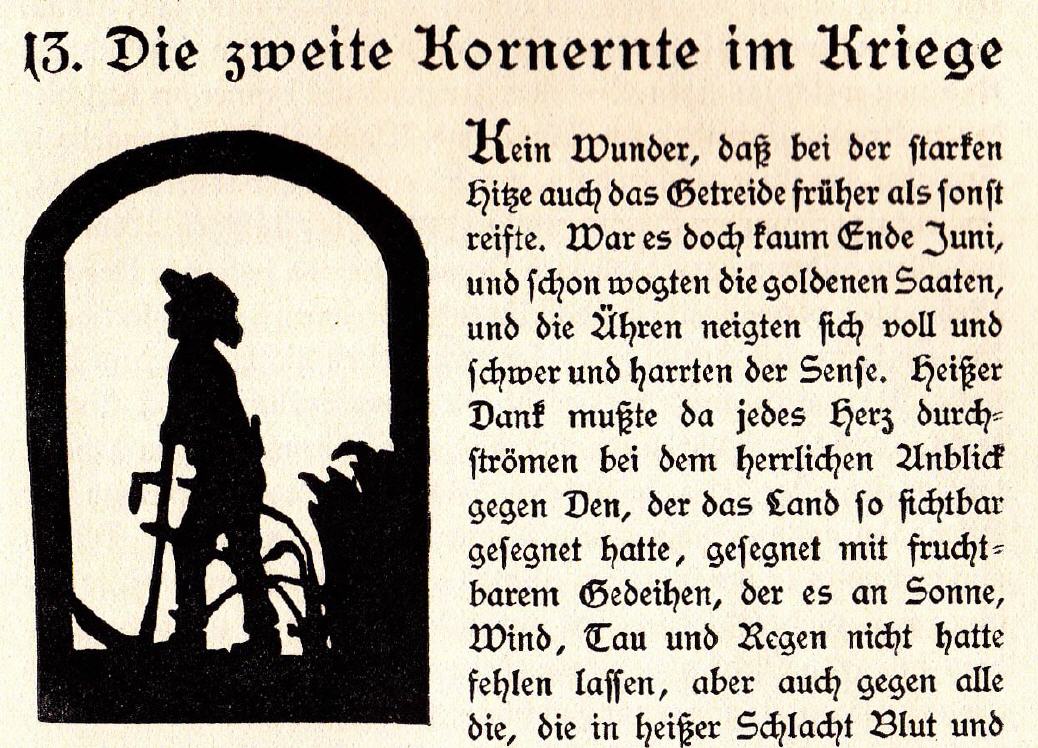
Kein Wunder, dass bei der starken Hitze auch das Getreide früher als sonst reifte. War es doch kaum Ende Juni und schon wogten die goldenen Saaten und die Ähren neigten sich voll und schwer und harrten der Sense. Heißer Dank musste da jedes Herz durchströmen bei dem herrlichen Anblick gegen Den, der das Land so sichtbar gesegnet hatte, gesegnet mit fruchtbarem Gedeihen, der es an Sonne, Wind, Tau und Regen nicht hatte fehlen lassen, aber auch gegen alle die, die in heißer Schlacht Blut und Leben einsetzten, um das Vaterland zu schützen, dass nicht die heimatlichen Gefilde verwüstet, zerstampft, womöglich in Asche lägen.
Wie freudig waren sie vor fast einem Jahre in den Kampf um die heiligsten Güter gezogen! Unvergleichlich großartig war doch dieser Ausmarsch! Zu tausend und abertausend kamen sie auf den Landstraßen daher geschritten und doch wie ein Mann, alle beseelt von derselben tiefen Begeisterung und demselben unerschütterlichen Willen. Wie viele, viele hatten ihre Treue schon mit dem Tod besiegelt und die Lazarettzüge riefen es immer wieder ins Gedächtnis, wie viele junge blühende Menschen ihre Jugendkraft, ihre frische Gesundheit, ihre geraden Glieder dem Vaterlande geopfert hatten und Schmerzen und Wunden trugen.
Wenn so ein Lazarettzug einlief, dann wurden wohl auch die frohen Gesichter der jungen Soldaten, die ihm auf ihrer Fahrt zur Front begegneten, ernster und für einige Minuten dämpfte sich ihr Gesang. Aber sonst hatten diese Transportzüge wirklich etwas Erhebendes und man muss sie gesehen haben diese prächtigen Burschen auf den laubgeschmückten Wagen!
Der Krieg dauerte doch schon so lange; sie wussten also ganz genau, was ihnen bevorstand und dennoch – als ob sie zu einem Feste führen! Und von welch launigen Einfällen zeugten nicht immer die verschiedenen Kreideaufschriften an Türen und Wänden. Der eigenartigste Zug aber, den ich je gesehen habe, war der einer Eisenbahnerabteilung. In richtige Sommerhäuschen mit Wetterfahnen, lustigen Wimpeln und allem anderen dazu gehörigen Drum und Dran hatten sie die alten Viehwagen verwandelt. Selbst blühende Geranien in weißlackierten Blumenkästen vor den blanken Fenstern fehlten nicht. Auf dem hintersten Wagen veranstaltete gerade eine Hauskapelle mittels Blechdeckel, Trichter, Schürhaken und anderer Instrumente ein Phantasiekonzert. Der Weg zu unseren Feldern führte ein Stück an der Eisenbahn entlang; wir haben immer tüchtig gewinkt.
Da ich wusste, dass es in der Erntezeit abends oft spät werden würde, so zog ich es vor, während dieser Zeit gar nicht nach Hause zu gehen, sondern bei Frau Dietrich zu übernachten. Die gute Frau meinte zwar etwas verlegen, sie könne mich nicht gut in ihrem Hause unterbringen, sie habe kein Bett mehr für mich. Aber ich erklärte ihr, das sei auch nicht nötig; sie habe doch Stroh genug. So schlief ich denn recht behaglich auf Stroh in einer leeren Kammer.
Bei dem guten Wetter ging die Ernte rasch vonstatten. Ein Bruder von Frau Dietrich mähte, wir rafften und banden die Garben. Eingefahren haben wir die Wagen ohne männliche Hilfe. Gerne hätten wir das Getreide mit dem Flegel gedroschen, aber wir hatten nicht Leute genug dazu. So mussten wir es „maschinen“ lassen. Aber bei Nachbarsleuten habe ich an Regentagen ein paar Mal mit gedroschen; das Geklapper ist zu lustig. Und wie die Körner springen!
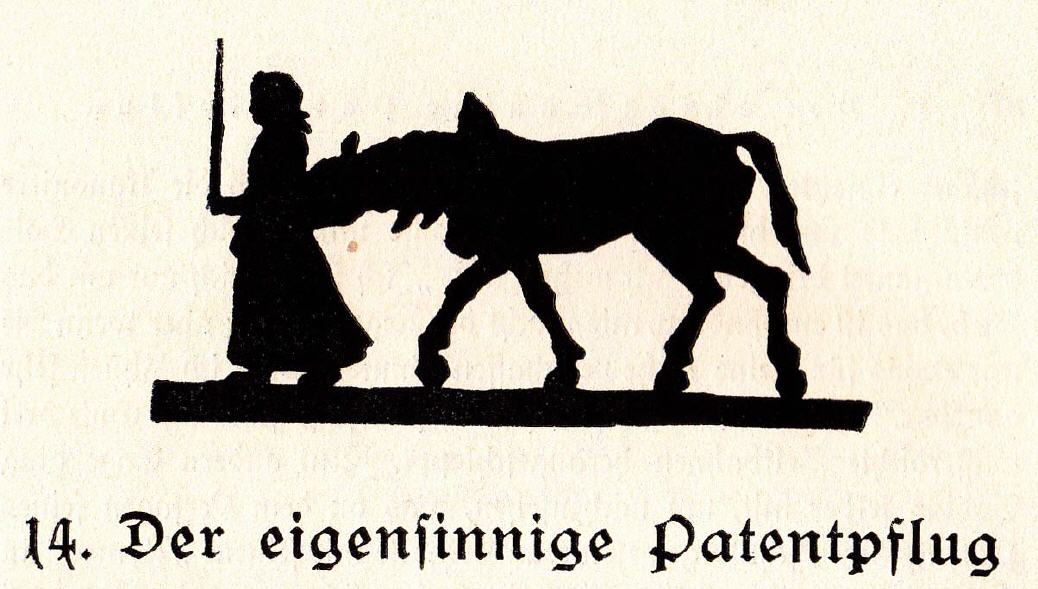
Die Bauernregel sagt: Der Pflug soll gleich hinter dem Erntewagen kommen. Deshalb wollte ich auch sogleich mit dem Stürzen der Stoppelfelder beginnen. Für das eine Haferfeld, welches sehr mit wildem Klee und anderem Unkraut durchwachsen war, lieh mir Tobias, der Nachbar aus dem Hause gegenüber, seinen Patentpflug, der besonders gute Arbeit tun sollte. Wohlgemut wollte ich anfangen, aber wie ich mich auch abmühte, die Sache kam nicht zum Klappen.
Hilfe suchend spähte ich nach allen Seiten und gewahrte endlich zu meiner Freude einen dienstfreien Soldaten von der Ballon-Abwehr-Kanone, die in einem nahe liegenden Felde stand. Ich winkte ihn heran, in der Hoffnung, es sei vielleicht ein Bauer, der mir mit Rat und Tat beistehen könnte. Und es war ein Bauer, aber helfen konnte er mir nicht. Dann rief er seinen Freund Willi, dann den „schönen Hermann“. Vier weitere Kameraden folgten von selber. Zu sechs schafften sie, dass ihnen der Schweiß von der Stirne rann. Bald zog der eine die Kette stramm; dann machte der andere sie doppelt lang. Bald legte einer den Pflugbaum rechts, worauf ihn ein anderer nach links versetzte. Abwechselnd wurde das Vordergestell hoch und tief geschraubt, auch der Kolter wurde heraus genommen und wieder eingesetzt.
Es war wirklich rührend, wie sich die wackeren Feldgrauen um die „junge Frau“ bemühten. Einer fragte ganz teilnehmend, ob „Meiner“ im Westen oder im Osten stände und ob ich schon lange statt seiner ackern müsste. Endlich entfernte ich kurzerhand die ganze Patentvorrichtung und fuhr ganz schön auf und ab, bis als neues Hemmnis ein furchtbarer Regenschauer einsetzte. Auch in diesem Falle erwiesen sich die Kanoniere mitfühlend und hilfsbereit. Einer wollte mir sogleich einen Soldatenmantel bringen. Ich wehrte ab: „Ich sorge mich nur um das Vieh, das ist empfindlich, mir macht der Regen nichts; aber wenn Sie mir etwas für meine Kühe verschaffen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.“ Und wirklich, ehe ich’s mich versah, hatte der Gute drei wasserdichte Zeltbahnen herangeschleppt. Am andern Tage ging Tobias selber mit, um nachzusehen, was an dem Versagen seines Patentpfluges schuld gewesen sei. Er hatte mit seinem „Romeo“ in einem angrenzenden Felde zu tun, da traf es sich ganz gut. „Romeo“ war die Jammergestalt eines alten Kleppers, aber für Tobias sein Ein und Alles. Wiederholt suchte ich dem Manne klar zu machen, dass er dem armen blinden Tiere wohl keinen besseren Freundesdienst erweisen könnte, als ihn durch einen schmerzlosen Tod von seinem elenden Dasein zu erlösen. Aber ich wurde allemal abgewiesen. Der Romeo sei noch sehr „allert“ und wenn er nicht die Gicht in den Beinen hätte, dann krähte er so vergnügt wie ein junger Hahn.
Zu meinem Ärger war Nero, dieses Untier, mir nachgelaufen und durch nichts zum Umkehren zu bewegen. Mein Entsetzen wuchs erst recht, als die wüste Dogge auf dem Exerzierplatz in alle Soldatengruppen rannte und jedem Pferd kläffend an den Leib sprang. Freund Tobias wollte den Hund fangen und gab mir darum seinen Gaul zu halten. So zog ich denn über den Exerzierplatz mit dem Kuhfuhrwerk, den Klepper hinter mir her zerrend, während mein Begleiter schnaufend, fluchend und peitschenknallend hinter dem Ausreißer herjagte.
Es muss ein schönes Bildchen gewesen sein. Alle Soldaten grinsten. Ich schämte mich sehr, Nero desto weniger. Im Gegenteil: voller Tücke sprang er dem Romeo an die Nase, dass das arme Tier vor Schrecken in die Knie sank. Zum Glück konnte ich es schnell wieder hochreißen. Als Nero nun aber wie ein Irrwisch in die aufrückenden Kavallerieabteilungen fuhr und dort Verwirrung und Aufregung hervorrief, winkte ich Tobias, dass wir schleunigst verdufteten. Wir konnten es beim besten Willen nicht verhindern, dass der Kerl sein Unwesen trieb; da war es dann wohl das Beste, wir verleugneten ihn.
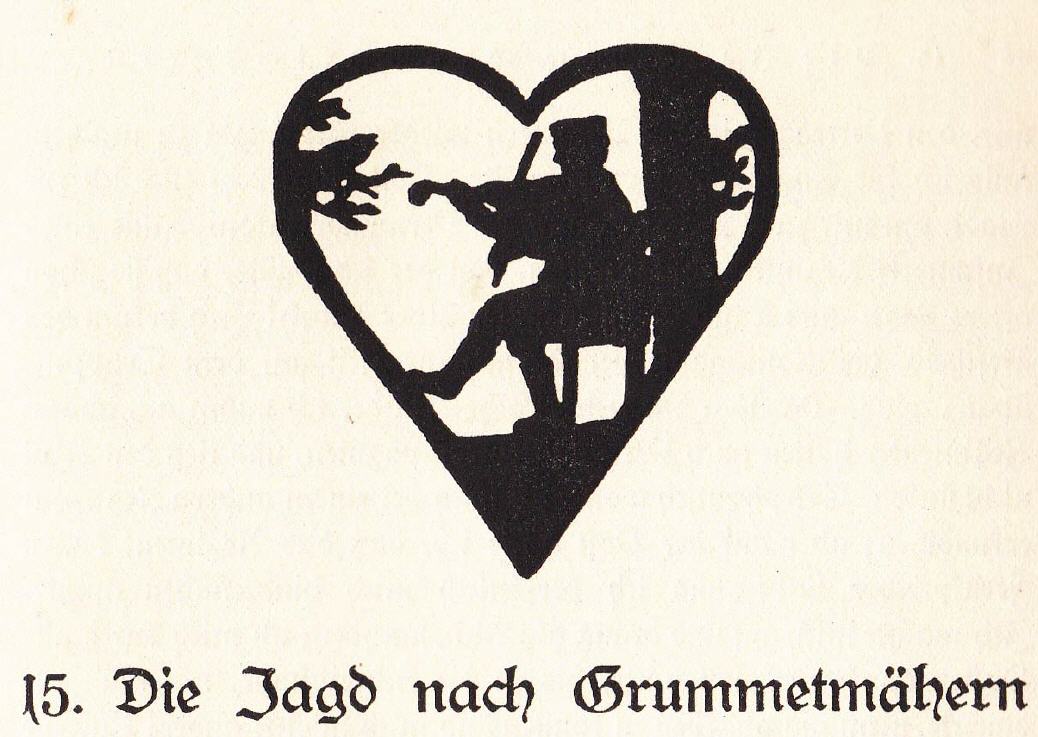
Die Zeit verging rasch über der vielen Arbeit. Ehe wir es uns versahen, musste Grummet gemacht werden. Nun war wieder die Not mit den Arbeitern. Im Vorjahre waren die Wiesen, die so weit entfernt lagen, überhaupt nicht zum zweiten Male gemäht, sondern als Hammelweide versteigert worden. Mit Recht hatte aber Franz Dietrich gesagt, in diesem Jahre käme es sehr aufs Zweitfutter an. Seine Frau dürfe unter keinen Umständen etwas davon verkaufen oder sonst irgendwie abgeben. Wenn sie nicht den ganzen Ertrag der Wiesen in ihre Scheuer bekäme, müssten sie ein Stück Vieh abschaffen, ein bedeutender Verlust für die Wirtschaft.
Beyer Öhmchen hatte vergeblich nach Mähern für die große Fläche gesucht. Endlich war er einig geworden mit ein paar Männern, die das Futter mähen und trocknen wollten um die Hälfte der Ernte. Geld wollten die Leute nicht annehmen, sie wussten sehr wohl, dass gutes Futter in diesem Jahre bei weitem wertvoller war. Außerdem wollten sie den abgemähten Boden als Viehweide benutzen. Was wäre natürlicher gewesen, als dass sie möglichst viel stehen ließen?
Als ich von dem Handel hörte, erklärte ich: mitnichten! Beyer Öhmchen hatte zwar wenig Hoffnung, dass ich eine bessere Lösung fände; auch Frau Dietrich schüttete den Kopf. Aber Beyers Nikla, der gerade in Heimaturlaub war, versprach mir, den Vertrag mit den Männern wieder rückgängig zu machen, falls ich für Tagelöhner sorgen wollte.
Voll Zuversicht eilte ich zur Stadt, um mir zwei Soldaten aus der Verwundeten-Kompanie eines Infanterie-Regiments auszubitten, von der ich wusste, dass sie schon öfter Leute aufs Land geschickt hatte. Aber oh weh! Ich bekam den Bescheid, die Kompanie befinde sich zurzeit auf dem Truppenübungsplatz. Das war ein rechter Schreck; aber ich nahm an, andere Regimenter hätten auch Verwundeten-Kompanien und ließ den Mut nicht sinken. Telefonisch wollte ich mich bei einem andern Regiment erkundigen; aber auf der Post hörte ich, dass das Regiment keinen Fernsprecher habe und ich persönlich mich hinbemühen müsste.
Ich machte mich auf und drang glücklich, nachdem ich mich durch alle Posten durchgearbeitet hatte, bis in die Schreibstube, wo man bedauerte niemand abgeben zu können und mich in eine andere Kaserne verwies. Ungesäumt eilte ich dorthin. Hier wurde ich nicht so oft angehalten, musste jedoch erst die Paroleausgabe abwarten. Auch hier war das Ergebnis gleich Null. Als darum Beyers Nikla abends kam und mir glückstrahlend mitteilte, es sei ihm gelungen, den Mähern zu kündigen, konnte ich seine Freude nicht so herzlich teilen. Von meinen Misserfolgen sagte ich natürlich nichts.
Andern Tags machte ich mich in aller Frühe auf, um bei den Kavallerie-Regimentern mein Heil zu versuchen; von einem Ende der Stadt rannte ich zum andern. Es wurde mir aber tatsächlich siedend heiß, als ich lauter abschlägige Antworten bekam. Meine Aussichten schmolzen immer mehr zusammen. Eine ähnliche Angst habe ich nur früher als Schulkind vor der Rechenstunde ausgestanden. Bei mir dachte ich: Du hast dir eine schöne Suppe eingebrockt, nun musst du sie auch auslöffeln. Dann beruhigte ich mein Gewissen wieder: Es war doch gut gemeint und wenn es gelänge, hätte ich der Frau Dietrich einige Wagen Futter und eine Milchkuh gerettet.
Mit ziemlich wenig Hoffnung ging ich endlich zu den Pionieren; denn man sagte, es seien wenig Bauern darunter, sondern hauptsächlich Handwerker. Allein schlimmer als bei den andern konnte es mir auch hier nicht gehen. Ich traute jedoch meinen Ohren kaum, als mir zwei Soldaten versprochen wurden. Nun hatte ich die Sorge, ob die Leute auch gut mähen könnten. Aber es löste sich alles in Wohlgefallen auf. Beyers und Frau Dietrich waren bald überzeugt: Den beiden Soldaten tat’s so leicht keiner nach. Weniger Glück hatte ein alter Bergbauer, dem ich zwei Arbeiter verschaffte. Während der eine sich wenigstens bemühte, etwas zu leisten, genoss der andere die frische Luft und die schöne Aussicht. Mähen konnte er gar nicht, er war überhaupt kein Bauer, sondern Komiker von einem Varieté-Theater. Aber er spielte wunderhübsch „Viggelin“, erzählte mir der Bauer.

Das Wetter war günstig. Wir bekamen alle Wagen ohne einen Regentropfen in die Scheune. Etwa vierzehn Tage hatten wir auf der großen Wiese zu tun. Während der Mittagspause hielten die Nachbarsmädchen gern ein Schläfchen im kühlen Schatten. Ich zog es vor, dann in der schönen Gegend umherzuschweifen, bis es Zeit war, das Futter wieder zu wenden oder zu häufen. Auf einer dieser Streifzüge fiel mein Blick auf einen Wegweiser: Nach Grünwinkel.
Mir ging es durch den Kopf: „Grünwinkel – ah, da ist ja der Landsturmmann Koch her aus dem Bataillon meines Vaters. Frau Koch kommt ja öfter, wenn sie hinunter zur Stadt geht, zu meiner Mutter und fragt nach ihrem Manne. Sie wird sich gewiss freuen, wenn ich sie besuche und ihr Nachrichten vom Bataillon mitbringe. Ich kenne sie zwar noch nicht persönlich, aber ich lerne sie dann eben kennen.“
Nachdem ich etwa eine halbe Stunde gewandert war, begegnete mir eine Bauersfrau, die mir das Haus beschrieb. Frau Koch freute sich sehr, als ich ihr meinen Namen genannt hatte und lud mich ein, etwas bei ihr zu bleiben. Sie setzte mir köstlich frische Eier vor und ließ sich von mir berichten. Wir waren sehr schnell bekannt miteinander und nun klagte sie mir auch, dass sie noch keine Arbeiter habe finden können. Ich versprach ihr, mich in ihrem Interesse zu bemühen und ihr auch Bescheid zu sagen. Dann beredete ich die Sache mit einem von unsern Mähern. Er wollte sich noch für weitere acht Tage Urlaub geben lassen und auch Frau Kochs Wiesen mähen.
Es war ein sehr schöner Sonntagmorgen, als ich mit meiner Schwester den etwa zwei Stunden weiten Weg in das Bergdörfchen machte, um die gute Botschaft zu überbringen.
Feierlich still war es auf der Flur. Die Bauersleute, die uns begegneten, trugen ihr Sonntagsgewand. Die Hände, die sich die ganze Woche in emsiger Arbeit gerührt hatten, hielten das Gebetbuch. Aus dem Tale herauf hörten wir die Glocken der Stadt, die ihre hellen und tiefen Stimmen wie zu einem vollen Choral vereinten. Es ging schon auf Mittag zu, als wir uns auf den Heimweg machten und die Sonne meinte es überaus gut. Als darum ein Bauernwagen daher fuhr, zögerten wir nicht lange, die gute Reisegelegenheit zu ergreifen. Ich rief den Rosselenker an und der freundliche Mann ließ uns gern aufsitzen.
Ich stieg vorne zu ihm auf den Kutschersitz, während meine Schwester sich hinten im Kastenwagen den anderen Insassen, zwei alten Weibern und einen kleinen Jungen, zugesellte. Der Mann hatte bald ein Gespräch mit mir begonnen, in dessen Verlauf ich ihm auch von meiner ländlichen Tätigkeit erzählte. Er war sehr misstrauisch und wollte mich auf die Probe stellen. Deshalb fragte er während unserer Unterhaltung zwischendurch ganz unauffällig nach dieser oder jener Arbeit, nach dem Einfluss der Vorfrüchte auf die nächste Saat und dergleichen mehr. Ich hatte sofort seine Absicht gemerkt und freute mich, wenn ich auch ganz unbefangen tat, dass ich jedes Mal mit der rechten Antwort aufwarten konnte. Als er seiner Sache sicher war, war er sehr freundlich und wies das Trinkgeld, das ich ihm beim Absteigen in die Hand drücken wollte, stolz zurück mit den Worten: „Eine Dame, die sich um den deutschen Bauernstand so verdient macht, hat auf meinen Wagen freie Fahrt!“

Eines schönen Tages, als ich gerade von einem Streifzug zur Wiese zurückkam, fand ich die Nachbarmädchen in einem heftigen Wortwechsel mit einer fremden Frau; schon von weitem hörte ich die erregten Stimmen. Auf meine erstaunte Frage erklärte mir eins der Mädchen, diese dreiste Person habe sich unterstanden, nicht nur zwei oder drei Birnen von jenem Baum aufzuheben, sondern zwei Körbe und einen Sack mit dem Obst zu füllen. Sie habe sich auch von niemand dabei stören lassen. Ich beobachtete selber: der ganze Zorn der Mädchen, der sich über sie ergoss, glitt wirkungsvoll an ihr ab.
Da – als sie mit Auflesen fertig war, trat sie ruhig an eine der Klägerinnen heran mit den Worten: „Wollen Sie sich bitte überzeugen?“ und hielt ihr einen Zettel vor. Es war die Bescheinigung, dass sie die Eigentümerin des betreffenden Baumes sei. Nun waren die Mädchen sehr verlegen und entschuldigen sich. Aber die Frau sagte: „Wenn Sie mein Eigentum immer so eifrig gegen fremde Eingriffe verteidigen, so muss ich Ihnen sehr dankbar sein; dann weiß ich wenigstens meine Birnen gut bewacht. Fahren Sie nur so fort.“
Das wurde gern gelobt und schon am nächsten Tag bot sich wieder Gelegenheit dazu. Zwei junge Mädchen und ein Knabe hoben die frisch gefallenen Früchte auf und als nicht viele unten lagen, scheuten sie sich nicht, den Baum zu schütteln. Das ging denn doch zu weit. Wie aus der Kanone geschossen, stürzten die Wächterinnen hinzu und es entspann sich ein Wortgefecht von größter Heftigkeit; denn die Diebinnen waren auch nicht auf den Mund gefallen, sondern zahlten mit gleicher Münze zurück. Die beiden Mäher und ich verfolgten den Kampf als Neutrale. Allein an den lebhaften Armbewegungen und dem Mienenspiel ließen sich die einzelnen Stadien erkennen. Einige Sätze drangen bis an unseren Ohren wie: „Ihr dummen Bauern, seid doch ruhig!“ und das darauf folgende „Ihr wärt noch froh, wenn Ihr Bauern wärt, weiß der Kuckuck, wo Ihr her seid, ihr Schlauderen, ihr Lumpengesindel!“ Doch auch diesmal ergab sich, dass es viel Lärm um nichts war; denn kurz darauf erschien die schriftlich beglaubigte Besitzerin und stellte die „Räuberbande“ als ihr Verwandten vor, die ihr nur ein Stückchen vorausgegangen waren.
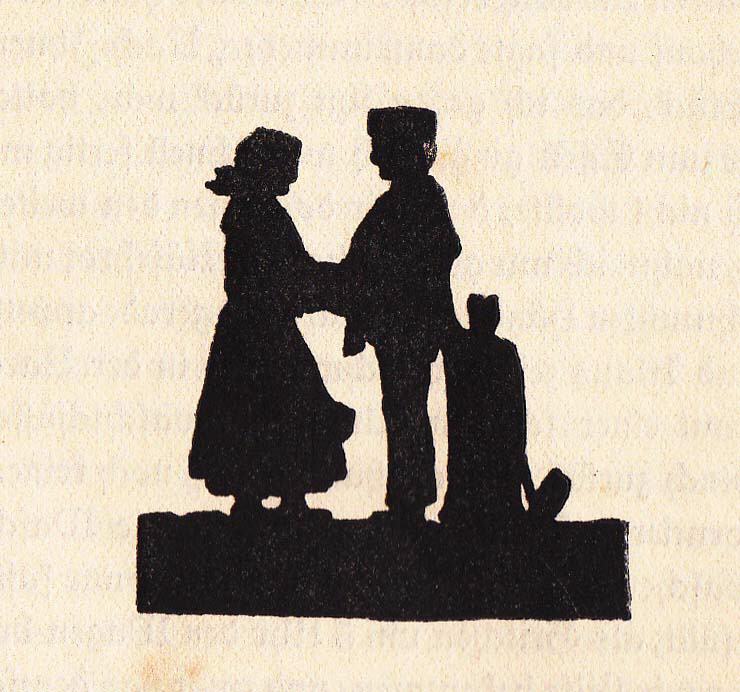
18. Feldgraue Nothelfer
Die Kartoffelzeit stand wieder bevor. Schon waren die Keller geräumt zur Aufnahme der Vorräte. Diesmal sollten wir mehr zu arbeiten haben; denn wenn wir auch einerseits nicht so viele Felder mit Kartoffeln bestellt hatten wie im Vorjahre, so waren wir andererseits ganz allein auf uns angewiesen, denn Tagelöhner hatten wir keine bekommen. Im letzten Herbst hatten wir oft zu fünf und sechs in der Reihe geschafft. Aber wir zwei wollten uns schon fleißig dran gegeben, wir würden’ schon packen. Ja, der Mensch denkt, aber –
Frau Dietrich, die seit mehreren Tagen stark erkältet war, klagte eines Abends über große Hitze und stechende Schmerzen. Am folgenden Morgen konnte sie nicht mehr aufstehen und der herbei gerufene Arzt stellte Lungenentzündung fest. Jetzt war guter Rat teuer. Ich konnte die Kranke doch nicht den ganzen Tag sich selbst überlassen mit den kleinen Kindern! Anderseits war es die höchste Zeit, mit der Kartoffelernte zu beginnen, zumal ich jetzt mutterseelenallein war.
Da dachte ich an die beiden alten Frauen in unserer Nachbarschaft. Die Mimi Jane oder die Mimi Rieke würde doch gewiss, wenn ich sie darum bäte, im Haushalt nach dem Rechten sehen; sie hatten ja selbst nicht viel Land zu bearbeiten. Und Knandel Gritchen, der ich meine Not klagte, erbot sich, mir abends den Wagen zu bringen, um die Säcke heimzufahren; Knandels waren immer sehr gefällig und nett.
Um die kurzen Tage nach Kräften auszunützen, schlief ich für diese Zeit wieder im Dorfe. Um 5 Uhr erhob ich mich vom Stroh. Den Kaffee hatte ich schon abends in meine Thermosflasche gefüllt, so konnte ich mich sogleich auf den Weg machen, es waren immerhin bald ¾ Stunde zu gehen bis aufs Feld.
Es war ein wunderschöner Sonnenaufgang, als ich zum ersten Male so allein hinauswanderte. Aber die Sorgen ließen mich nicht zu rechtem Genuss der prächtigen Farben kommen. Wie sollte ich nur fertig werden in den großen Feldern? Dabei eilte es, denn die leeren Stücke sollten noch mit Korn bestellt werden. Mein Weg führte an der Ballon-Abwehrkanone vorbei, und wie ich das Geschütz und die dazu gehörige Mannschaftsbaracke im Morgengrauen erkannte, fiel es mir auf einmal ein, wie freundlich sich doch damals die Soldaten um den eigensinnigen Patentpflug bemüht hatte, und der Offizier, dem das Kommando über die Ballon-Abwehrkanone übertragen war, hatte mir bei diese Gelegenheit gesagt, ich dürfe mir jederzeit dienstfreie Soldaten holen, wenn ich Helfer benötigte; nur solle ich vorher beim Wachtmeister darum einkommen.
Ich zögerte einen Augenblick, aber unter dem Druck der Verhältnisse fasste ich mir ein Herz und schritt auf den Posten zu. „Ich möchte beim Herrn Wachtmeister anfragen, ob ich einen Mann bekommen könnte zur Hilfe beim Kartoffelausmachen.“ Der etwas erstaunte Soldat ging in die Baracke und brache mir den guten Bescheid, nach der nächsten Ablosung käme einer. Und was für einer kam! So habe ich noch keinen Menschen schaffen sehen! Das gute Beispiel wirkte ansteckend. Wir hackten beide um die Wette ohne aufzusehen. Der Kanonier warf einen Stein. „So weit müssen wir in der nächsten Stunde sein!“ Gewöhnlich waren wir aber schon vor der Zeit am Ziel; dann steckten wir uns ein neues.
Am nächsten Morgen kam der Mann schon um 7 Uhr ins Feld. Er hatte immer abwechselnd einen Tag dienstfrei und einen Tag Bereitschaft. An den Bereitschaftstagen durfte er sich zwar nicht weit vom Geschütz entfernen, aber das Kartoffelfeld lag noch keine zwei Minuten davon ab. Es war wirklich rührend, dass er immer wiederkam; denn Tagelohn erhielt er nicht, wenn ich ihm auch öfter etwas aus meiner Börse zusteckte.
Als ich ihn einmal fragte: „Gingen Sie denn nicht lieber mit Ihren Kameraden aus an Ihren dienstfreien Tagen? Sie haben doch gar nichts davon, dass Sie hier für fremde Leute Kartoffeln ausgraben.“ Da antwortete er: „Bis Sie fertig sind, lasse ich Sie nicht im Stich. Sie arbeiten ja auch für fremde Leute und haben nichts davon; ich werde mich doch nicht von Ihnen beschämen lassen.“ Es war völlig freier Wille, wenn er kam. Der Wachtmeister musste ihm wohl Erlaubnis dazu geben; aber ihm befehlen konnte er es nicht. Und wie oft mochte er müde gewesen sein, wenn er die Nacht zuvor Wache gehabt hatte!
Einmal stand er noch Posten, als ich ins Feld ging. Der Wachtmeister, der mir begegnete, fragte mich, wie ich eigentlich mit Klaus zufrieden sei. Ich antwortete: „Der schafft für drei.“ Da ging er in die Baracke mit den Worten: „Na, ich will sehen, ob wir Ihnen heute auch so einen guten Helfer schicken können.“ Kurz drauf erschien der Offizier unter der Türe. Nachdem er mich freundlich gegrüßt hatte, wandte er sich an den Pfosten: „Klaus, wollen Sie mit dem Fräulein Kartoffeln buddeln?“ „Zu Befehl, Herr Leutnant.“ „Wollen Sie den Klaus wieder mitnehmen?“ fragte er nun mich. Als ich freudig bejahte, winkte er mir der Hand: „Gut, Sie sind abgelöst, gehen Sie mit und seien Sie fleißig.“ Ich fand es wirklich ungemein liebenswürdig und entgegenkommend. Die Mannschaften verehrten ihren Vorgesetzten aber auch alle und wären für ihn durchs Feuer gegangen.
Das Kartoffelfeld war recht mit Unkraut überwuchert und der Boden sehr hart. Aber wir rechneten aus, dass wir beide für eine Fläche von einem Morgen nur vier Tage Zeit brauchten. Allerdings half uns einmal ein Dritter, wenn auch nicht mit Aushacken, so auf andere Weise. Ein ebenfalls dienstfreier Kanonier sah uns eine Weile zu und versicherte mir: „Ich würde Ihnen gerne helfen, wenn noch eine dritte Hacke da wäre.“ Lachend erwiderte ich: „Wenn weiter nichts fehlt! Sehen Sie das viele Unkraut, das erschwert uns die Arbeit so sehr. Wenn Sie es ausrupfen, kommen wir schneller vorwärts.“ Gehorsam bückte er sich und riss ein Unkrautbüschel nach dem andern aus. Und es half tatsächlich. Fast eine Stunde schaffte er mit anerkennenswertem Fleiß, bis ihn ein anderer abrief.
Die Mädchen, die im angrenzenden Felde Kartoffeln aushoben, guckten verwundert nach meinen Helfern. Als Klaus zum Essen fort war, sagten sie: „Mit dem täten wir aber nicht zusammen arbeiten, er ist zu eifrig. Wir machen’s doch lieber gemütlich.“ Dafür hatten Klaus und ich aber auch allabendlich vier bis fünf Säcke mehr als sie. Wenn sie morgens gegen 9 Uhr ins Feld kamen, lag meist schon eine ganz ansehnliche Strecke hinter uns und auf das freundliche „Guten Morgen“ der Mädchen, meinte Klaus: „Der Morgen ist bald um; man kann schon fast Mahlzeit sagen.“ Wenn er dann losschaffte, hatte ich Mühe nachzukommen.
Als einmal der Wachtmeister im Vorbeigehen sagte: „Sie könnten doch eigentlich dem Fräulein ein bisschen an ihren Reihen nachhelfen!“ sagte er trocken: „Ach wo, det jibts bei uns nich, hier muss jeder seinen Strang ziehen.“ Doch später war er milder und arbeitete auch ab und zu ein Stückchen großmütig an meinen Furchen, nicht aber vorher anzukündigen: „Na ich werd’ Sie man en bisken unter de Arme jreifen, ich bin gar nicht so.“ Um einen kleinen Vorsprung zu gewinnen, bot ich ihm wiederholt zu trinken an: „Haben Sie nicht Durst; dort steht der Krug. Trinken Sie doch Most!“ Aber bald hatte mich der Schlauberger durchschaut und sagte dann immer: „Nach Ihnen, trinken Sie erst!“
Das Stück, das ich gegen ihn zurück war, holte ich mittags nach, wenn er zum Essen ging. Ich war schnell fertig mit der Mahlzeit. Weil ich nicht wollte, dass mir das Essen den weiten Weg zugetragen würde, nahm ich mir gewöhnlich ein Käsebrot mit. Nur waren meine erdbeschmutzten Hände eigentlich nicht gerade appetitlich. Als ich sie aber lachend Klaus zeigte, verschwand er in der Baracke und kam kurz darauf mit einer schönen Aluminiumwaschschüssel und einem frischen Handtuch zurück. So fein hat’s gewiss noch keiner gehabt, dass ihm ein uniformierter Diener mitten im Feld die Waschschüssel hält zum Händewaschen!
Am letzten Tage hatten wir fast 30 Säcke mit Kartoffeln gefüllt, als Gritchen um 5 Uhr den Wagen brachte. Nachmittags hatten wir Hilfe bekommen und zwar von demselben, der uns das Unkraut ausgerupft hatte. Ich konnte ihm eine unbenutzte Hacke von einem Nachbarfeld holen. Da gestand aber der Soldat, er habe noch nie in seinem Leben Kartoffeln gebuddelt. Er war nämlich aus der Reichshauptstadt; aber Klaus wusste Rat: „Ach wo, de Fräulein lernt dir.“ Der wackere Berliner stellte sich auch wirklich sehr geschickt an und hielt getreulich bis zum Abend aus.
Die Kartoffeln waren nun glücklich eingeheimst, gleichwohl kam ich noch ein paar Mal hilfesuchend zu der Abwehrkanone. Das „Mädchen für alles“ versagte nie. Als ich die Felder umgeackert hatte, säte mir ein Kanonier das Korn. Als ich eine tiefe Grube auswarf für die Runkelrüben, half mir ein Kanonier beim Graben. Der Pflug wurde stumpf, sogleich setzte mir ein Kanonier ein paar frisch geschärfte Schare ein. Als ich von dem Berge Obst holte, ging ein Kanonier mit, um auf die Bäume zu steigen. Kurz, die Kanoniere waren zu allem zu gebrauchen.
Das sahen die Bauern im Dorf und da ich nun einmal den Anfang gemacht hatte, kamen sie auch angelaufen, um sich Soldaten zu holen. Bald hier, bald dort machte sich die fleißige Schar auf den Feldern nützlich und im Dorfe sagte man allgemein lobend: So sollten alle sein.

Schluss
Das bunte Herbstlaub war längst wieder zur Erde gewirbelt. Kahl und öde streckten die Bäume ihre Zweige gegen den Novemberhimmel. Kahl und öde lagen auch die Felder da. Nur hier und da standen noch ein paar letzte Kohlköpfe auf dem Acker und ein paar Futterrüben. Im ersten Jahr war ich bis Weihnachten hinausgegangen, diesmal war früher Schluss. Infolge der guten trockenen Witterung konnten die meisten Arbeiten frühzeitig erledigt werden. Zum Glück! Denn sehr bald setzten Fröste ein.
Frau Dietrich hatte sich, dank ihrer gesunden Natur, wieder rasch erholt. Zwar hatte sie ihre frische Farbe noch nicht wieder und fühlte sich auch noch etwas matt, aber sonst ging es ihr ganz gut. So konnte ich sie beruhigt verlassen, als die Arbeit so weit getan war. Mit herzlichen Worten nahmen wir voneinander Abschied. Lachend erinnerten wir uns des ersten Tages, des 9. August 1914, wo wir uns beide etwas voreinander gescheut hatten. Frau Dietrich gestand mir, dass sie damals eigentlich doch rechtes Misstrauen gegen das Stadtfräulein gehabt habe, aber jetzt sagte sie: „Ja, wenn ich Euch nicht gehabt hätte!“
Sie war wirklich rührend in ihrer Dankbarkeit; wo sie mir eine Freude machen konnte, tat sie es, und einmal sagte sie: „Wenn Ihr einmal krank würdet, dann ließ ich Haus und Acker und Kinder und Vieh im Stich und käme, Euch zu pflegen.“ Und ihr Mann vergaß nie in seinen Briefen einen besonderen Gruß an das Fräulein. Und doch waren nicht nur Dietrichs der nehmende Teil. Hatte ich nicht auch viel Schönes in dieser Zeit erlebt? Die reiche Natur hatte sich mir offenbart in ihrem Werden und Vergehen, so im großen wie im kleinen. Die Saaten hatte ich keimen und wachsen und reifen sehen und hatte nicht nur als Fremdling abseits gestanden, sondern selbst den Acker dazu vorbereitet. Niemals sonst hatte ich so schön Zeit und Gelegenheit für meine besondere Liebhaberei, der Beobachtung von Tieren, nachzugehen. Wenn ich nicht mit Arbeitstieren zu tun hatte, so waren es die Vögel, die Käfer und die Frösche, die mich mit ihrer Munterkeit erfreuten und mir, wenn ich allein war, die Zeit verkürzten.
Nicht der schlechteste Gewinn, den mir meine Tätigkeit brachte, war das Zusammenleben mit den Landleuten. Das ist ja überhaupt eine der schönen Seite des Krieges, dass einmal die Volksgenossen sich über die engen Klassen und Standesgrenzen hinaus kennen, verstehen und schätzen lernen. Mich freute es auch allemal, wenn ich die Landleute von einem ungerechten Vorurteil gegen die Städter abbringen konnte.
Mein schönster Lohn aber war das frohe Bewusstsein, in Deutschlands großer Zeit mich auch an meinem Teil als Glied des Ganzen nützlich machen zu dürfen.